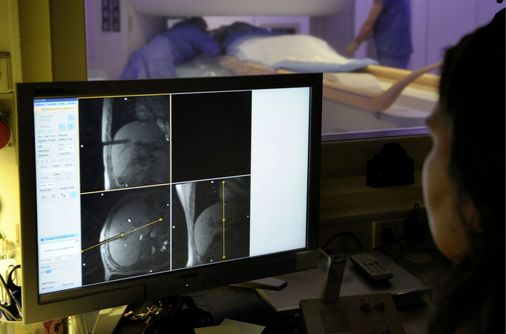Der Streit um die Studiengebühren und die Finanzierungsfrage an der Universität Freiburg geht in die nächste Runde. Nun liegen zwei neue Vorstösse vor.
So haben erstens 208 Angestellte der Universität einen Aufruf unterzeichnet, wie gestern von der Studierendenschaft Agef in einem Communiqué mitgeteilt wurde. Die Unterschriften seien innerhalb einer Woche gesammelt worden, heisst es. Im Aufruf wird kritisiert, dass Studierende und Doktorierende durch die fehlende finanzielle Unterstützung des Kantons geschwächt würden. Die Unterzeichnenden verlangen, dass das Rektorat den Dialog mit der Freiburger Verwaltung sucht, um die nötigen Mittel für die Studien- und Forschungsfinanzierungen zu erlangen. Zudem weisen sie darauf hin, dass die Universität dem Kanton einen finanziellen Mehrwert einbringe und gleichzeitig von «unschätzbarem sozialen und kulturellen Wert für Stadt und Kanton» sei. Die Debatte um die Erhöhung der Studiengebühren müsse dringend weitergeführt werden. Denn sie setze sich mit der Frage nach der Stellung und Wichtigkeit der Universität in der Gesellschaft auseinander. Der Aufruf stellt sich auch «gegen die absolute Politik, die bis anhin für das Thema der Universitätsfinanzierung vorherrschte».
Zweitens wandten sich – zufälligerweise ebenfalls gestern – 253 Doktoranden der Universität in einem offenen Brief an den Staatsrat, wie der Verband des Personals öffentlicher Dienste (VPOD) mitteilte. Sie fordern, dass die Kantonsregierung ihre Entscheidung zur Erhöhung der Studiengebühren nochmals überdenke. Die Studiengebühren-Erhöhung sei «skandalös» angesichts der oft jetzt schon prekären finanziellen Situation der Doktoranden.
Neue Ombudsstelle ab 2018
Uni-Rektorin Astrid Epiney wollte die zwei Vorstösse gestern nicht kommentieren. Sie räumte dafür auf Anfrage mit einem anderen Missverständnis auf, auf das ein Leser die FN aufmerksam machte. In der bisherigen Kommunikation wurde nämlich nie erwähnt, dass zur Studiengebühren-Erhöhung noch die sogenannte Grundgebühr von 115 Franken dazukommt, sowohl für Studierende als auch für Doktorierende. Rechnet man diese mit ein, so bezahlen Bachelor- und Masterstudierende neu 835 statt wie bisher 655 Franken, Doktorierende 295 statt 115 Franken. «Die Grundgebühr ist aber nicht Teil der Einschreibegebühr», so Epiney.
«Der Einsatz zugunsten der Doktorierenden ist völlig legitim», ergänzt der Unicom-Leiter Marius Widmer. «Diesbezüglich laufen Gespräche mit allen Beteiligten im Rahmen der dafür vorgesehenen Strukturen.» Allerdings setze die Universität zahlreiche Ressourcen spezifisch für die Doktorierenden ein. Deshalb wäre es nicht gerechtfertigt gewesen, sie komplett von der Erhöhung der Einschreibegebühren zu verschonen. Es stimme zwar, dass die Westschweizer Universitäten keine Einschreibegebühren für Doktorierende erheben – wohl aber die Deutschschweizer Universitäten, mit teilweise deutlich höheren Ansätzen. Zudem gebe es etwa auch an der ETH Lausanne ein einmaliges Schulgeld von 1200 Franken für Doktorierende. Es sei auch nicht sinnvoll, die Saläre der Diplomassistenten mit Lohnklassen der Verwaltung zu vergleichen. Zudem hätten die Gehälter der Diplomassistenten in den letzten 20 Jahren deutlich zugenommen. Äusserungen der Doktorierenden zur Zufriedenheit am Arbeitsplatz nehme man zudem sehr ernst. Daher werde ab Januar 2018 auch eine entsprechende Ombudsstelle eingerichtet.
Marianne Meyer Genilloud, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Erziehungsdirektion, wies ihrerseits darauf hin, dass die Kantonsregierung bis zur Beantwortung der entsprechenden Anfrage der SP-Grossratsmitglieder Kirthana Wickramasingam (Bulle) und Xavier Ganioz (Freiburg) zu den Studiengebühren nicht Stellung zum Thema nehmen werde. Und danach sei es vorab eine Angelegenheit des Grossen Rates, weiter über die Problematik zu diskutieren.