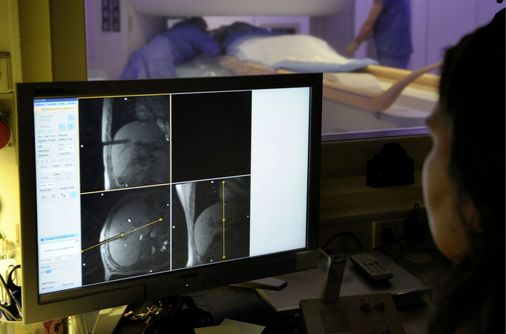«Wenn ich mich damals nicht selbst gerettet hätte, wer weiss, was heute aus mir geworden wäre», erinnert sich Alfred Kressler* an den Sonntagnachmittag im Jahr 1964, als er, 17-jährig, vor dem Landwirt in St. Antoni floh, der ihn jahrelang körperlich und seelisch misshandelt hatte. Er kehrte nie mehr zurück. Es war der Anfang eines neuen, selbstbestimmten Lebens. Heute ist Kressler 70-jährig, glücklich verheiratet und Vater zweier erwachsener Kinder. Ausser seiner Frau wussten nur wenige von seinem Schicksal, das er mit zahlreichen Opfern fürsorgerischer Zwangsmassnahmen in der Schweiz teilt. Als er aber 2011 den Film «Der Verdingbub» von Markus Imboden im Kino sah, schüttelte es ihn durch: «Die Tränen liefen mir über die Wangen und ich habe gedacht: So war es. Das habe ich erlebt.» Der Film und die Tatsache, dass die Politik begann, sich dieses dunklen Kapitels der Schweizer Geschichte anzunehmen, führten dazu, dass Kressler im letzten Jahr den Mut fand, seiner eigenen Geschichte nachzugehen. «Früher sah man das als normal an, was mit einem gemacht wurde. Es war nicht üblich, über diese Dinge zu reden.» (Siehe auch Kasten.)
Antworten in Bananenkisten
Kressler wusste, wer seine Eltern und seine 14 Geschwister waren, dass er heimatberechtigt in Wünnewil/Düdingen war, und vermutete, dass er in Bösingen geboren ist. Wie es dazu kam, dass er als Kleinkind ins damalige Waisenhaus von Tafers gebracht wurde, von wo aus die schlimmen Geschehnisse ihren Lauf nahmen, wusste er aber nicht. Auf der Suche nach Belegen, die seine Geschichte dokumentierten, begab er sich auf die Gemeindeverwaltungen von Bösingen, Wünnewil und Düdingen. Doch dort fand er nichts. Sodann wandte er sich ans Staatsarchiv von Freiburg. Dieses wiederum verwies ihn ans Oberamt in Tafers. Und dort wurde er endlich fündig: «Der Oberamtmann zeigte mir zwei Bananenschachteln, in denen alle Dokumente über das Waisenhaus Tafers lagen.»
Archivgut schlecht sortiert
Alfred Kressler hatte Glück, dass er so schnell und verhältnismässig einfach Unterlagen zu seiner Vergangenheit gefunden hat. Denn nicht selten ist das Gegenteil der Fall. Es gibt mehrere Gründe, welche die Suche erschweren können: Ein Problem ist, dass die Archivbestände in den Gemeinden oft unzureichend sind, wie François Blanc, Historiker beim Staatsarchiv, erklärt. Er beschäftigt sich in seiner Freizeit mit dem Archiv seiner Gemeinde Corbières. «Einerseits sind oft gar nicht mehr viele Dokumente vorhanden, weil sie schlichtweg fortgeworfen wurden. Andererseits wissen die Gemeindemitarbeiter oft gar nicht, was sie in ihrem Bestand haben. Und schliesslich wurden die Dokumente damals nicht nach den heutigen Archivierungsstandards klassiert: Es gibt keine Inhalts-, Namens- und Stichwortverzeichnisse», so Blanc. Konkret bedeute das, dass die Gemeindeschreiber bei einer Anfrage von Opfern fürsorgerischer Zwangsmassnahmen Sitzungsprotokolle oder die Korrespondenz des Gemeinderates regelrecht durchkämmen müssten.
Massnahme nicht protokolliert
Ein anderes Problem bei der Suche nach Beweisen kann in der Art und Weise liegen, wie eine Fremdplatzierung erfolgte, erklärt Archivar Charles-Edouard Thiébaud, der beim Staatsarchiv die eingehenden Fälle recherchiert: «Es gab drei Typen von Fremdplatzierungen: Entweder wurde sie von einem Bezirksgericht im Rahmen einer Scheidung angeordnet oder wenn die Eltern mit der Justiz in Konflikt kamen. In diesen Fällen finden wir die entsprechenden Urteile in der Regel problemlos. Ebenso wenn die Gemeinde Urheberin der Massnahme war und ein Friedensgericht entschied, weil sich die Eltern widersetzt hatten. Wenn aber die Gemeinde, allenfalls auch mit Hilfe der Pfarrei, ein Kind direkt platzierte, hängt der Erfolg der Suche davon ab, ob die Vorgänge protokolliert wurden.» Am schwierigsten sei es, wenn die Eltern von sich aus ein Kind fremdplatziert haben, so Thiébaud. «Dann finden wir meistens nichts.» Weil die Opfer zudem manchmal nicht wissen, wo ihre Eltern zum Zeitpunkt der Fremdplatzierung lebten, passiere es auch, dass man im falschen Kanton Nachforschungen betreibe.
Hilfe von kantonalen Stellen
Weil es für die Opfer fürsorgerischer Zwangsmassnahmen oft schwierig ist, ihre Vergangenheit zu rekonstruieren und zu belegen, hilft nun aber der Kanton. Konkret können sich Betroffene an das Freiburger Staatsarchiv und die Opferberatungsstelle des Jugendamtes wenden. Letztere unterstützt die Personen auch beim Einreichen eines Gesuchs um Gewährung des Solidaritätsbeitrages, wie er vom Bundesgesetz über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981 (AFZG) vorgesehen ist (siehe FN vom 29. April).
Gemeinden in der Pflicht
Aber auch die Gemeinden sind in der Pflicht, sie müssen Betroffenen einfach und kostenlos Zugang zu den Akten gewähren. Einwände in der Art von «mangelnden Ressourcen, um ein Zugangsgesuch zu bearbeiten» oder «eine zu grosse Arbeitslast» können nicht entgegengehalten werden, wie das kantonale Amt für Gemeinden präzisiert. In den Gemeinden sei diese Botschaft angekommen, sagte Manfred Raemy, Oberamtmann des Sensebezirks auf Anfrage. Weil die Gemeinden bis zum 31. März 2018 aber einige Anfragen von Opfern erwarten, zählen sie auf die Unterstützung durch das Staatsarchiv: «Wenn klar ist, nach welchen Dokumenten die Gemeindeschreiber suchen müssen, verringert das ihren Arbeitsaufwand, der ordentlich werden könnte», so Oberamtmann Manfred Raemy.
* Name von der Redaktion geändert.
Entschädigung
«Wieder gutmachen kann man das nicht»
In seinem Gesuch an das Bundesamt für Justiz um Gewährung eines Solidaritätsbeitrages schildert Alfred Kressler seine unfassbar schlimmen Erlebnisse und belegt diese mit Dokumenten.
Er beschreibt, wie er als Zehnjähriger im Schweinestall, der dem ehemaligen Waisenhaus Tafers angeschlossen war, schuften musste und vom Knecht sexuell missbraucht wurde und niemand etwas dagegen unternahm, obwohl die Behörden informiert waren. Wie die Ordensschwestern die Kinder triezten und den Jungen, die sich in die Hosen machten, die nassen Hosen zur Strafe über den Kopf zogen. Wie er mit 14 Jahren von der Armenverwaltung Wünnewil zu einem kinderlosen Bauern in St. Antoni geschickt wurde, der ihn von fünf Uhr in der Früh und nach der Schule bis spät abends ackern liess, ihn schlug und einen Wolfshund auf ihn hetzte, so dass er zum Arzt gehen musste. «Was ich nie vergessen werde: Beim Frühstück kehrte man immer die angetrocknete Seite des Brotes zu mir mit der Bemerkung, dass man sich immer von vorne bediene.»
Kressler schreibt weiter: «Es waren für mich die traurigsten Jahre, denn der Bauernhof war einsam auf einem Hügel; der Bauer hatte auch keine Kinder, was mich am meisten schmerzte.»
Wieder gutmachen könne man das nicht, sagt er im Gespräch mit den FN. «Aber ich denke, ich habe einen Anspruch auf Entschädigung, schliesslich hat man uns auch geschädigt.» Den Brief ans Bundesamt für Justiz schliesst Kressler, der vierzehn Geschwister hat, mit dem Satz: «Was ich heute noch nicht weiss, und vielleicht auch nie erfahren werde, ist, warum gerade ich allein als kleines Kind nicht bei meinen Eltern aufwachsen durfte.»
* Name von der Redaktion geändert.