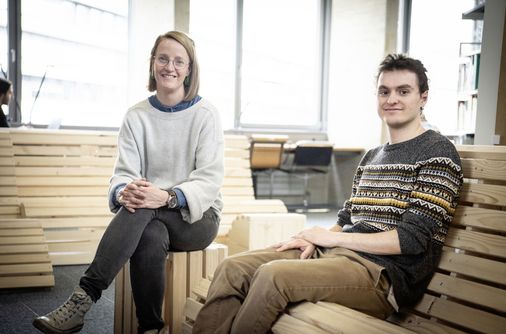Vor einiger Zeit habe ich in der Zeitung das Bild einer älteren Frau gesehen, die inmitten von ein paar wenigen Habseligkeiten–den resignierten Blick nach innen gewendet–auf dem Trottoir sass. «Diese Spanierin», so die Bildlegende, «wurde auf die Strasse geworfen, weil sie ihre Miete nicht mehr bezahlen konnte.»
Solche und ähnliche Bilder sieht man jetzt regelmässig in der Zeitung oder am Fernsehen. Aussergewöhnlich daran ist bloss, dass sie uns geografisch immer näherrücken. Früher war die Armut in Afrika, also in sicherer Entfernung von der Schweizer Grenze zu Hause. Wir waren–in den Worten eines französischen Moralisten–stark genug, um zu ertragen, was anderen zustiess. Jetzt steht sie plötzlich vor unserer Haustür, die Armut. Oder hat sie schon angeklopft?
Ich gehe langsam auf die Sechzig zu und wirkliche Armut–ich meine, dass man hungrig zu Bett geht oder die einzigen Paar Schuhe nur am Sonntag tragen darf, damit sie länger halten, das kenne ich nur aus den Erzählungen meiner Eltern und Grosseltern. Und auch später, als die materielle Not nicht mehr in den Eingeweiden zu spüren war, hielten sich unsere Vorfahren an elementare Sparsamkeitsgrundsätze. Nach der sakrosankten Überzeugung meines Schwiegervaters zum Beispiel durfte man sich ein Auto erst leisten, wenn man genug für zwei zusammengespart hatte. «Nobel muss die Welt zugrunde gehen!», das war der Standardsatz, mit dem er das Leben auf Pump und die grassierende Wegwerfmentalität zu geisseln pflegte. Mein Schwiegervater war bestimmt kein Wirtschaftsexperte. Aber muss man das sein, um vorauszusehen, dass es nicht ewig gut geht, wenn man mehr ausgibt, als man einnimmt?
Ich gebe zu, dass die täglichen Meldungen über ringsum wachsende Schuldenberge und Finanzkrisen mein Vertrauen in die Unumstösslichkeit unseres Wohlstandes nicht gerade gefestigt haben. Seither frage ich mich, ob wir nicht doch wieder lernen sollten, den Gürtel etwas enger zu schnallen, so wie das Zigtausende auch in der reichen Schweiz bereits lernen mussten, weil sie an oder sogar unter der Armutsgrenze zu leben gezwungen sind. Aber wir, die restlichen 90 Prozent, all die Satten, Verwöhnten, Gutbetuchten? Wenn Sie mich fragen, ich habe die grössten Bedenken, dass wir die Kurve kriegen werden. Ich fürchte, dass wir dereinst zu den unbegabtesten Armen gehören werden, die man sich vorstellen kann. Richtige Armutsversager. Die Zukunft, hat ein Humorist einmal gesagt, macht mir Angst, weil sie immer näherkommt.
Die alte Spanierin, die von der Not auf die Strasse getrieben wurde, hat ihr Dach über dem Kopf und damit ihre Menschenwürde verloren. Wenn diese Grenze überschritten wird, dann ist plötzlich alles wieder möglich. Wir haben guten Grund, uns davor zu fürchten. Ich weiss nicht, wie man das Individuum vor einem solchen Verlust der Menschenwürde bewahren kann. Aber vielleicht sollten wir beizeiten lernen, in Würde ärmer zu werden, um nicht am Ende würdelos zu verarmen.
Hubert Schaller unterrichtet Deutsch und Philosophie am Kollegium St. Michael. Er ist unter anderem Autor der Gedichtbände «Trommelfellschläge» (1986) und «Drùm» (2005). Als Kulturschaffender ist er in einem FN-Kolumnistenkollektiv tätig, das in regelmässigem Rhythmus frei gewählte Themen bearbeitet.