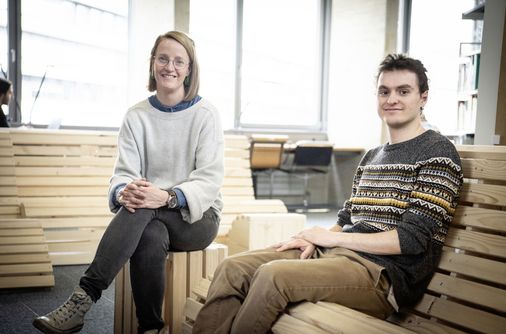Für Caritas-Direktor Hugo Fasel hat die Bekämpfung der Armut in der reichen Schweiz oberste Priorität, wie er im Interview betont.
Wie schlimm ist das Armutsproblem in der Schweiz?
Die Armutsproblematik ist das wichtigste und grösste sozialpolitische Problem der Schweizer Zukunft.
Der Bund gab dieses Jahr bekannt, dass er nach Abschluss seines fünfjährigen Programms gegen Armut seine Mittel für die nächsten fünf Jahre reduziert. Was sagen Sie dazu?
In der Schweiz heisst es immer noch, die Armutspolitik sei Sache der Kantone. Aus heutiger Sicht stimmt das aber nicht mehr. Denn sehr wichtig ist die Armutsprävention, und da geht es um Investitionen in die Weiterbildung, um Ergänzungsleistungen für Familien, um Kinderkrippen und um sozialen Wohnungsbau. Die Kompetenzen für all diese Bereiche liegen grösstenteils beim Bund. Der Bundesrat will nun aber in den nächsten Jahren nur noch 500 000 Franken pro Jahr für die Armutspolitik ausgeben. Das ist absurd. Dieser bundesrätliche Entscheid beruht auf einem völlig überholten Bild von Armutspolitik.
Was können Sie gegen diese bundesrätlichen Pläne unternehmen?
Es braucht Überzeugungsarbeit im Parlament. Das ist aktives Lobbying für eine aktive Armutspolitik und funktioniert nur in Einzelgesprächen.
Sie vertreten also dezidiert die Meinung, dass die Schweiz mehr für ihre Armutspolitik tun muss?
Vor allem muss eine umfassende Sozialpolitik mehr sein als eine finanzielle Unterstützung. Sie muss auch die Prävention umfassen. Hier trete ich ganz klar für einen Paradigmenwechsel ein.
Wenn eine halbe Million Franken pro Jahr zu wenig ist – wie viel Geld braucht es dann?
Genau lässt sich das nicht beziffern. Aber beim sozialen Wohnungsbau geht es beispielsweise um Investitionen in die Zukunft, bei der Weiterbildung ebenfalls. Wenn es darum geht, den Herausforderungen der Digitalisierung zu begegnen, dann werden wir für die Verhinderung von Armut Hunderte von Millionen Franken investieren müssen. Wenn wir das nicht tun, dann entstehen die Ausgaben über die Sozialhilfe.
Wie beurteilen Sie die Rolle des Kantons Freiburg im interkantonalen Vergleich?
Freiburg hat immerhin einen Armutsbericht. Das ist erwähnenswert, weil nicht alle Kantone einen solchen Bericht vorgelegt haben. Es gibt Kantone, die sich dem Thema bis heute verweigern und entsprechende Vorstösse einzelner Kantonspolitiker abgelehnt haben. Leider hat sich der Staatsrat aber im Kanton Freiburg bislang immer gegen Ergänzungsleistungen für Familien ausgesprochen, die ein sehr gutes Instrument der Armutsbekämpfung darstellen.
Schaut man sich die Zahlen des Kantons an, so fällt auf, dass viele Armutsbetroffene gar keine Sozialhilfe empfangen.
Genau. Sie melden sich erst gar nicht bei der Sozialhilfe, wohl aus Scham. Sie versuchen, sich bis zum Schluss selbst zu retten, und viele machen Schulden.
Wie gross ist bei solchen Zahlen Ihrer Meinung nach die Dunkelziffer?
Aufgrund unserer Erfahrungen ist jede zehnte Person in der Schweiz armutsbetroffen. Die Dunkelziffer ist bedeutsam. Auch wir bei der Caritas werden immer wieder von Menschen angesprochen, die finanziell unter das Existenzminimum geraten sind. Das Problem ist: Wir haben die nötigen finanziellen Mittel auch nicht. Wir können kein Geld verteilen. Aber Caritas Freiburg berät die Menschen und hilft ihnen, zu ihrem Recht auf Sozialhilfe zu kommen.
Wer ist Ihrer Meinung nach besonders stark von Armut betroffen?
Es gibt ganz verschiedene Ursachen für Armut in der Schweiz. Eine wichtige Gruppe sind die Alleinerziehenden, bei denen es sich zu 90 Prozent um Frauen handelt. Wobei man betonen muss, dass diese Frauen eine wesentlich höhere Erwerbsquote haben als der Bevölkerungsdurchschnitt. Das heisst: Alleinerziehende arbeiten überdurchschnittlich viel. Weiter ist der Faktor Bildung eine zentrale und in der Bedeutung stetig wachsende Armutsursache. Dabei geht es nicht nur darum, ob jemand eine Berufsbildung hat, sondern auch darum, ob die Bildung, die er sich angeeignet hat, auf dem Arbeitsmarkt überhaupt noch gefragt ist. Die Berufswelt und der Arbeitsmarkt verändern sich relativ rasch, namentlich auch aufgrund der Digitalisierung. Hier geht es um Menschen, die ihren angestammten Job verloren haben und keine Weiterbildung absolvieren können. Menschen ab 55 Jahren sind davon besonders stark betroffen, auch hochqualifizierte. Sie haben es schwer, eine gleichwertige Arbeit zu finden. Ich denke da beispielsweise an die ganze Druckereibranche. Da haben sich ganze Tätigkeitsfelder schlicht aufgelöst.
Gibt es noch weitere Faktoren, die eine Rolle spielen?
Ja, vor allem ungenügende Löhne. Es ist das Phänomen der sogenannten Working Poor: Menschen, die zu 100 Prozent arbeiten und trotzdem kein existenzsicherndes Einkommen haben und ihre Familie von ihrem Lohn nicht ernähren können. Früher war vor allem das Verkaufspersonal im Fokus. Das stimmt aber längst nicht mehr. Betroffen sind beispielsweise auch Flugbegleiterinnen in Flugzeugen der Billig-Airlines.
Spielt der Migrationshintergrund eine Rolle?
Erstaunlicherweise eine sehr beschränkte. Sicher gibt es Menschen, die wir in die Schweiz holten, damit sie einfache, wenig qualifizierte Jobs machen. Wenn diese Jobs wegfallen, werden die Betroffenen arbeitslos. Armut hängt generell viel mehr mit der beruflichen Qualifikation einer Person zusammen als mit ihrer Nationalität. Armut ist kein Migrationsproblem.
Manchmal wird gefragt, wieso Sozialhilfe-Empfänger unbedingt ein Mobiltelefon haben müssen …
Das ist ignorant. Ohne Mobiltelefon und Mailadresse ist es heutzutage unmöglich, sich irgendwo um eine Stelle zu bewerben. Wie sollen sich denn diese Leute ohne Mobiltelefon jemals wieder im Arbeitsmarkt integrieren?
Wie beurteilen Sie die Armut in der Schweiz im Vergleich zu anderen Ländern, etwa in der Dritten Welt?
Hier muss tatsächlich niemand verhungern oder auf der Strasse schlafen – das ist aber nur so, weil wir die Sozialhilfe als wertvolle Institution haben. Denn wenn jemand seine Wohnung nicht mehr bezahlen kann, ist er im Prinzip relativ schnell auf der Strasse. Da zeigt sich, wieso die Sozialhilfe so wichtig ist.
In einer Herbstserie geben die «Freiburger Nachrichten» der Armut in diesem Kanton ein Gesicht. Wir gehen der Frage nach, was Armut ist und wo sie fundamentale Bedürfnisse tangiert.
Armut in der Schweiz, Armut in Freiburg
«Aufgrund unserer Erfahrungen ist jede zehnte Person in der Schweiz armutsbetroffen. Die Dunkelziffer ist bedeutsam.»
Zahlen und Fakten
Die Dimensionen des Armutsproblems
Laut Caritas-Schweiz-Direktor Hugo Fasel und dem Bundesamt für Statistik sind in der Schweiz rund 630 000 Personen von Armut betroffen. Das sind 7,5 Prozent der Gesamtbevölkerung. Darunter sind 260 000 Kinder. Insgesamt seien aber rund eine Million Schweizer armutsgefährdet, das seien gut zehn Prozent der Bevölkerung. Arm sei, wer unter dem Existenzminimum lebe. Dieses sei kantonsübergreifend bei 32 Franken pro Tag definiert für Grundbedürfnisse wie Essen, Trinken, Kleider oder Transport. Die Miete sei darin nicht enthalten, weil hier die Zahlen von Kanton zu Kanton stark schwanken würden.
Freiburger Familien in Armut fehlen weiterhin die Ergänzungsleistungen
«Wir haben heute ein genaues Bild von der Armut im Kanton Freiburg.» Dies sagt Gesundheits- und Sozialdirektorin Anne-Claude Demierre (SP) zwei Jahre nach Veröffentlichung einer umfassenden Studie.
In diesen Armutsbericht flossen Zahlen von verschiedenen Quellen. So wurden anonymisierte Daten aus Steuererklärungen, Angaben über Sozialhilfe, Stipendien und Ergänzungsleistungen sowie Reduktionen auf Krankenkassenprämien berücksichtigt. Auch führte die Caritas im Kanton eine Telefonumfrage durch.
So lässt sich akkurat sagen, dass drei Prozent der Freiburger Bevölkerung in Armut leben und weitere zehn Prozent von Armut bedroht sind. Dem Kanton liegt viel daran, die Armut auch in Zukunft zu beobachten. «Wir aktualisieren die Studie nun alle fünf Jahre», so Demierre.
Schwieriger ist es für die kantonalen Behörden, Vergleiche mit anderen Kantonen anzustellen. Vergleichbar ist die Datenlage, wenn man sich nur auf die Zahl der Sozialhilfebezüger bezieht. «Freiburg liegt da deutlich unter dem schweizerischen Durchschnitt», sagt Demierre. Nebst dem Wallis habe Freiburg mit 2,4 Prozent die tiefste Quote in der Westschweiz. Gesamtschweizerisch beziehen 3,3 Prozent der Bevölkerung Sozialhilfe.
Demierre stellt auch fest, dass sich die Situation seit einer gewissen Zeit verbessert. So habe die Freiburger Bevölkerung nach 2005 um 23,5 Prozent zugenommen, die Zahl der Sozialhilfebezüger aber bloss um 12,2 Prozent. Am grössten sind die Risiken gemäss der Sozialdirektorin für Familien mit nur einem Elternteil oder für kinderreiche Familien. Unter den Sozialhilfebezügern sind die bis 17-Jährigen mit 30,3 Prozent am zahlreichsten – eine Folge der schwierigen wirtschaftlichen Lage ihrer Eltern. Hingegen liegt die Sozialhilfequote bei den über 65-Jährigen bei nur 0,2 Prozent. «Die verschiedenen Renten und die Ergänzungsleistungen decken da die Bedürfnisse fast ganz ab», erklärt Demierre.
Massnahmen greifen
Eine Tendenz zeigt der Sozialdirektorin auf, dass Freiburg bei der Bekämpfung der Armut auf dem richtigen Weg ist: Der Anteil der Sozialhilfebezüger bei den 16- bis 25-Jährigen geht in Freiburg so deutlich zurück wie sonst nirgends in der Schweiz. Für Demierre ist das auf mehrere Faktoren zurückzuführen: «Unsere Politik strebt danach, dass null Prozent der Jugendlichen links liegengelassen werden.» Sie denkt dabei etwa an die Massnahmen gegen Langzeitarbeitslosigkeit des «Integrationspool+». Von den Betroffenen würden so rund die Hälfte wieder eine Arbeit finden. Demierre erwähnt auch eine neue Art der Zusammenarbeit zwischen IV, Sozialhilfe und dem Amt für den Arbeitsmarkt, die auch den gesundheitlichen Ansatz bei Stellensuchenden berücksichtigt.
Auch die niederschwelligen Angebote funktionieren laut Demierre gut. Dazu gehört die Notschlafstelle La Tuile, deren Angebot im letzten Jahr 515 Personen in Anspruch genommen haben. Oder Banc Public mit einem Angebot für Mittagessen und Tagesstrukturen, sowie Fri-Santé für Personen, welche die Kosten des Gesundheitssystems nicht bezahlen können. «Wir wenden ein gut funktionierendes, globales Konzept an, das auch im Armutsbericht aufgeführt ist», so die Staatsrätin. Die Massnahmen betreffen sämtliche Direktionen.
Lücke bei Ergänzungsleistungen
Doch wissen die von Armut betroffenen Personen auch, welches Angebot ihnen zur Verfügung steht? Bezüglich des Anrechts auf eine Reduktion der Krankenkassenprämien werden die Betroffenen direkt benachrichtigt, so Demierre. Es komme aber vor, dass Personen das Anrecht auf Sozialhilfe oder Ergänzungsleistungen nicht in Anspruch nehmen. Anonyme und vertrauliche Beratung und Unterstützung leistet dazu der Schalter «Freiburg für alle» an der Cribletgasse 13 in Freiburg.
Ein grosses Manko ortet Demierre aber weiterhin: die Ergänzungsleistungen für Familien. «Die Kantonsverfassung verlangt das», sagt Demierre. Tatsächlich wurde aber dieser Verfassungsartikel bisher nie umgesetzt. «Das Projekt figurierte schon in den letzten Finanzplänen des Staatsrats, wurde aber immer wieder verschoben. Es steht nun auch wieder im Finanzplan bis 2021. Ich hoffe, das Projekt jetzt dann bald in Vernehmlassung geben zu können.» Und Demierre betont: «Kinder dürfen kein Armutsfaktor sein.»
Zahlen und Fakten
Fast ein Viertel sind Working Poor
Unter den Sozialhilfebezügern im Kanton Freiburg sind die Stellensuchenden mit 38 Prozent vertreten. 23 Prozent der Bezüger haben eine Stelle, der Lohn reicht aber nicht aus. Wer Sozialhilfe bezieht, hat in 62 Prozent der Fälle nur die obligatorische Schule absolviert. In 28 Prozent sind die Betroffenen von ihrem Ehepartner getrennt oder geschieden. Bei 22 Prozent spielen auch gesundheitliche Probleme mit. Innert kurzer Zeit sank der Anteil der 18- bis 25-Jährigen um 8 Prozent.