Mitten im Riederwald in St. Silvester: Vor 20 Jahren hat hier der Sturm Lothar grossen Schaden angerichtet. «Etwa drei Hektaren Wald waren komplett am Boden», sagt Anton Egger, Förster im Privatwald im oberen Sensebezirk (siehe Kasten). Was nicht umgefallen war, wurde später vom Borkenkäfer heimgesucht. Um den Wald, der in Besitz der Gemeinde St. Silvester ist, wieder nutzen zu können, musste er aufgeforstet werden.
Das Risiko verteilen
Vorher war der Riederwald in erster Linie ein dichter Fichtenwald. Neu wurden Weisstannen, Douglasien, Lärchen, Bergahorne, Linden sowie einzelne Eichen gesetzt, auf natürliche Weise sind Vogelbeerbäume und Weiden gewachsen. «Ziel war es, die einstige Monokultur zu diversifizieren: Je mehr verschiedene Bäume wachsen, desto mehr kann das Risiko bei einem nächsten Sturm verteilt werden», erklärt der Förster. Zugleich ist ein Mischwald eine gute Abwehrtaktik, um die Ausbreitung des Borkenkäfers und andere Krankheiten zu bekämpfen. Gezielt wurden in den Jahren nach Lothar Pflegearbeiten vorgenommen: Dornen oder mal einen schlecht wachsenden Baum entfernt, mehr Licht hineingebracht. Diese Pflegearbeiten subventioniert der Kanton mit 2000 Franken pro Hektare Wald.
Heute, 20 Jahre nach dem Sturm, hat sich der Riederwald recht gut erholt, die Spuren verblassen langsam. Doch dauert es noch mindestens weitere 20 Jahre, bis er wieder forstwirtschaftlich so genutzt werden kann wie vor dem Sturm. «Lothar war für die einzelnen Waldbesitzer eine Katastrophe. Es war schlimm, was wir damals angetroffen haben» sagt Anton Egger. Auf die Gesamtfläche Wald gesehen sei es aber nicht tragisch gewesen. «Im Gegenteil: Aus forstlicher Sicht war es für den Wald sogar eine Chance für einen Neuanfang.»
Käfer, Krankheiten und Klima
Dieser war aus heutiger Sicht nötig, denn Stürme und der Borkenkäfer sind das eine, das dem Wald zusetzt. Neuere Krankheiten wie das Eschentriebsterben oder ganz aktuell ein Pilz, der viele Bergahorne befällt, machen den Waldbesitzern und den Förstern das Leben schwer. «Es bereitet uns Kummer, dass wir nicht wissen, welche Baumart sich langfristig hält und welche nicht.» Zudem komme heute mit dem Klimawandel noch ein weiterer Faktor bei der Entscheidung hinzu, welche Bäume in einem Wald besser gedeihen als andere. «Es ist eine rechte Herausforderung abzuschätzen, wie wir der globalen Erwärmung begegnen sollen», sagt der Förster. Das Problem im Wald sei die Zeit: «Ein Baum hat eine 100 Jahre dauernde Generation. Wenn er 80 Jahre lang wächst und seine Wurzeln plötzlich nicht mehr tief genug in den Boden reichen, weil er den Grundwasserspiegel nicht mehr erreicht, dann verdorrt er.»
Er nimmt an, dass sich die Natur irgendwie anpasst, doch das dauere seine Zeit. «Einige Bäume sind anpassungsfähiger als andere.» Fichten zum Beispiel sind anfälliger, wenn das Wasser knapper wird und die Temperaturen steigen. Der Förster ist deshalb überzeugt: Fichten werden in Zukunft nur noch in Höhenlagen über 700 Metern gedeihen. «Aus dem Sense-Mittel- und Unterland werden sie verschwinden.» Und das, obwohl die Fichte Jahrzehnte lang der «Brotbaum» der ganzen Schweiz war. Fichten wachsen gut und sind auf dem Holzmarkt immer noch die beliebteste Holzart, insbesondere als Bauholz, weil sie gut verarbeitet werden kann.
Kleine und grössere Wälder
Privatwaldbesitzer im oberen Sensebezirk zu überzeugen, ihren Wald ebenfalls zu diversifizieren, gehört zu den Aufgaben von Anton Egger. Die forstlichen Strukturen im Kanton Freiburg sehen vor, dass den Privatwaldbesitzern vom Staat ein Förster als fachlicher Berater zur Verfügung gestellt wird. In seiner Verantwortung sind Miniwäldchen von gerade mal 600 Quadratmetern und grössere Waldflächen bis zu 50 000 Quadratmetern, im Besitz von kleineren Gemeinden, Pfarreien und Privatpersonen.
Beides habe Vor- und Nachteile, sagt er. Die grösseren Waldgebiete, die sich eher im Voralpengebiet befinden, seien wegen des Geländes mit Berghängen, Bächen und Weiden schwieriger zu erschliessen. Kleinere Wälder seien von der Zugänglichkeit einfacher zu bewirtschaften. «Doch sind die Waldgebiete manchmal so klein, dass man kaum einen Baum fällen kann, ohne dass dieser auf das Waldstück des Nachbarn fällt.»
Auffassungen variieren
Deshalb gehört es unter anderem zu seinen Aufgaben, mehrere Waldbesitzer von einem eigentumsübergreifenden Holzschlag zu überzeugen, sogenannten koordinierten Holzschlägen. Diese sind für die Eigentümer interessant, weil sich die Kosten auf mehrere Parteien verteilen.
Das sei nicht immer einfach, sagt er. Denn nicht alle hätten die Einsicht und Sensibilität, welche Art von Eingriffen in ihrem Wald nötig und erwünscht seien. Der Wald war früher als Privateigentum ein wertvolles Kapital, das gezielt eingesetzt wurde. Das sei teilweise immer noch zu spüren, sagt er. Der Wald soll dann genutzt werden, wenn es dem Eigentümer passt: zum Bau einer Scheune oder um Brennholz zu gewinnen und nicht, weil es nötig ist, um eine Überalterung zu vermeiden.
Vergessene Wälder
Bei anderen Waldbesitzern sei der Bezug zu ihrem Besitztum verloren gegangen. «Sie haben den Wald vielleicht von ihrem Grossvater geerbt, leben aber heute in Städten oder weit von ihrem Wald entfernt, in Berufen, die nichts mehr damit zu tun haben.» Oder noch schlimmer: Erben vergessen, dass ihnen ein Stück Wald gehört, so dass der Unterhalt jahrelang vernachlässigt wird. Und schliesslich geht es ums Geld: Die Preise auf dem Holzmarkt sind tief. «Mit einem kleinen Holzschlag lässt sich keine Rendite mehr erzielen.» Ändern könnte man dies, wenn die Nachfrage nach einheimischem Holz steigen würde. «Doch viele Hausbauer beziehen lieber Holz aus dem Ausland, auch wenn die Ersparnis am Ende kaum 3000 Franken ausmacht.» Es sei absurd, sagt er: «Wir liefern unser Holz zum Teil nach China, weil der Transport dahin viel zu billig ist. Dafür beziehen wir unser Bauholz aus Deutschland und östlicheren Ländern. Und dabei hätten wir direkt vor der Haustüre einen regional nachwachsenden Rohstoff.»
All diese Faktoren zusammengenommen, machen die Aufgabe eines Försters im Privatwald zur Herausforderung. «Ich kann meine Argumente bringen, doch am Ende entscheidet immer der Besitzer, welche Arbeiten in seinem Wald ausgeführt werden.» Zwingen könne ihn niemand. Und auch wenn es nicht immer einfach sei: «Ich würde den Beruf jederzeit wieder ergreifen», sagt der 58-Jährige, der seit 1985 als Förster arbeitet.
«Es bereitet uns Kummer, dass wir nicht wissen, welche Baumart sich langfristig hält und welche nicht.»
Anton Egger
Förster








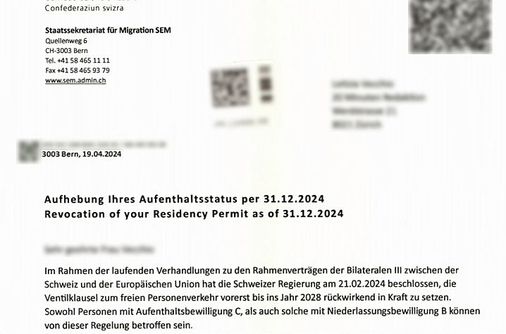
Kommentar (0)
Schreiben Sie einen Kommentar. Stornieren.
Ihre E-Mail Adresse wird nicht veröffentlicht. Die Pflichtfelder sind mit * markiert.