Exportweltmeister Deutschland fürchtet den Abstieg, von De-Industrialisierung ist die Rede. Unser Wirtschaftsreporter hat sich auf eine Industrie-Safari quer durch die Schweiz gegeben – er kommt zu einem klaren Fazit.
Ein Fussmarsch durch die Industriezone der Stadt Langenthal ist ein Erweckungserlebnis. Gefühlt braust alle fünf Sekunden ein schwerer Lastwagen durch die Bern-Zürich-Strasse. Die klappernden Ladungen verursachen einen ohrenbetäubenden Krach.
Willkommen in der Industriestadt Langenthal
Die Safari beginnt offensichtlich am richtigen Ort. «Langenthal ist eine Industriestadt, auf die 16’000 Einwohner kommen 14’000 Arbeitsplätze», sagt Edi Fischer, Präsident des Wirtschaftsverbandes Oberaargau. Wir treffen uns am Hauptsitz der Firma Motorex. Edi Fischer ist hier der Chef – seit 21 Jahren, mit erstaunlichem Erfolg.
Motorex produziert Schmierstoffe: Motorenöl, Getriebeöl, Hydrauliköl, Kühlschmierstoffe, Schmiermittel und Fette für fast jeden Typ von Maschinen, Anlagen und Fahrzeugen. Der Ausstoss beläuft sich auf rund 45’000 Jahrestonnen. Ein Drittel liefern Fabriken in Polen, Frankreich und in den USA. 30’000 Jahrestonnen produziert das Werk in Langenthal. Mehr als die Hälfte davon geht ins Ausland, nach Skandinavien, Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich, USA – bis nach China.
«Eine Mickymaus unter Giganten»
«Wir sind eine Mickymaus unter Giganten», sagt Fischer auf die Frage, wie man sich die Konkurrenz gegen Firmen wie Exxon, Chevron, Shell, BP, Total oder China Petroleum vorstellen sollte. Er zeigt durch das Bürofenster auf die Rohstofftanks, aus deren Inhalt die Motorex-Produkte entstehen. «Einige unserer wichtigsten Rohstoffe sind nicht mehr erdölbasiert», sagt er. «Wir arbeiten mit pflanzlichen Estern, die zum Beispiel aus Distelöl hergestellt werden. Motorex ist eine Chemiefirma. Ihr Geheimnis sind die Rezepturen.»
Mit dem pflanzenölbasierten Sortiment unterscheidet sich Motorex von den Erdölmultis und kann sich im Markt als CO2-sparender Schmierstoffhersteller profilieren. «Das ist ein erheblicher Wettbewerbsvorteil, den wir ursprünglich überhaupt nicht auf dem Zettel hatten», räumt Fischer ein.
Den frühzeitigen Eintritt in die Welt der Nachhaltigkeit verdankt die Firma Motorex nicht zuletzt ihren Kunden. Schon in den 1980er-Jahren suchten Schweizer Forstbetriebe nach biologisch abbaubaren Kettensägeölen. Diesen Bedarf haben inzwischen auch viele andere Kunden.
Fischer erzählt vom jüngsten Grossauftrag aus den USA. Die Betreiber eines riesigen Flusskraftwerks in der Nähe von Seattle seien ganz von sich aus mit der Anfrage an Motorex gelangt, ob ein Liefervertrag für ein biologisch abbaubares Hydrauliköl in das frisch sanierte Schleusensystem zu machen sei. Die schelmische Freude über den Gewinn eines solchen Auftrages direkt vor der Haustüre von Exxon und Chevron kann Edi Fischer nicht verbergen.
Grosse Löhne und noch grössere Mengen
Als er 2003 die Zügel im Unternehmen in die Hand bekam, bewegten sich die Exporte auf sehr tiefem Niveau. Das musste sich ändern, wenn Motorex seine über 100-jährige Geschichte fortsetzen wollte. Die stetigen Verbesserungen des Wirkungsgrades von Verbrennungsmotoren lassen den Bedarf an klassischen Motorenölen seit 50 Jahren sinken. Was gut ist für die Umwelt, wurde für Motorex zum Problem. Je geringer das Produktionsvolumen, desto teurer wird der Herstellungspreis pro Kilo. In dieser Fixkostenlogik waren die Langenthaler gezwungen, grösser zu werden – der Konkurrenz Marktanteile abzunehmen.
Das Kunststück gelang. Aus der Fabrik in Langenthal gelangen jährlich 2800 verschiedene Fluide in 95 Länder, abgepackt in über 8000 Gebindegrössen, vom Milliliterfläschchen bis zu ganzen Tankzügen. Die 300 Beschäftigten bewegen grosse Mengen. Ihre im Auslandvergleich hohen Löhne fallen neben den viel höheren Kosten für die Beschaffung der Rohstoffe nicht sehr ins Gewicht.
Exkurs in die Theorie
Der Besuch der Firma Motorex bestätigt, was auch die Wirtschaftsforscher Christian Rutzer und Rolf Weder von der Universität Basel 2021 in ihrem Buch «De-Industrialisierung der Schweiz?» (Springer Gabler, 2021) empirisch feststellen konnten: Die Schweiz ist ein fruchtbarer Boden für eine erfolgreiche, vor allem aber auch eine unerhört widerstandsfähige Industrie. Sie setzt sich aus unzähligen kleinen und mittelgrossen und weniger aus multinationalen Grossunternehmen zusammen.
Die Ökonomen weisen anhand eigener Berechnungen nach, dass die Produktivität des Schweizer Industriesektors in den vergangenen 20 Jahren etwa einen Drittel stärker zugenommen hat als jene des Dienstleistungssektors. Produktivität, definiert als Ausstoss pro Kopf in Mengen oder Franken, ist eine der wichtigsten Grössen, um die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen zu messen. Im Fall von Motorex war eine starke Produktivitätssteigerung nötig, um im schrumpfenden Schmiermittelmarkt kompetitiv zu bleiben.
Allein der Vergleich zwischen dem Dienstleistungssektor und dem Industriesektor beweist freilich noch nicht, dass sich die Produktivität der Industrie tatsächlich verbessert hat. Man könnte mit guten Gründen argumentieren, dass der Dienstleistungssektor einfach unproduktiver geworden ist. Die These wäre nicht völlig abwegig. Schliesslich verschaffte das Bankgeheimnis der Finanzbranche während vieler Jahre einen Wettbewerbsvorteil, der sich 2009 mit einer einzigen Gesetzesänderung sofort in Luft auflöste.
Veränderungen im Wirtschaftsgefüge, die sich aufgrund solcher und ähnlicher disruptiver Ereignisse ergeben, würden Rutzer und Weder als «ganz normalen Strukturwandel» beschreiben. Das Auf und Ab von einzelnen Wirtschaftssektoren, die sich den veränderten Umweltbedingungen besser oder schlechter anpassen können, ist nicht das Gleiche wie eine De-Industrialisierung.
Rutzer und Weder beschreiben diese als Prozess, «der fundamental neu und anders ist und zu einer Entwicklung führt, welche vieles auf den Kopf stellen könnte – mit allfälligen, ungeahnten negativen Konsequenzen für Wohlstand, Beschäftigung und Einkommensverteilung in einer Volkswirtschaft wie der Schweiz.»
Hysterie in Deutschland
Die Angst vor einer solchen Entwicklung ist der Grund, weshalb die im europäischen Vergleich derzeit ungewöhnlich schwache Wirtschaftsleistung Deutschlands zu einer bisweilen schon fast hysterisch anmutenden öffentlichen Diskussion in unserem Nachbarland über die Gefahr einer «De-Industrialisierung» angestossen hat.
Alte Industriegesellschaften wie die Schweiz oder Deutschland zeichnen sich unter anderem durch das Selbstverständnis aus, Güter herstellen und exportieren zu können, welche die Welt haben will. Es gibt in diesen Ländern die weitverbreitete Ansicht, dass Wohlstand ohne Industrie nicht möglich ist. Die Sorge um die Industrie geht Hand in Hand mit der Sorge um den eigenen Wohlstand.
Doch ob das Industriesterben in einem Land von «normaler» oder «fundamentaler» Natur ist, lässt sich zu einem frühen Zeitpunkt typischerweise nur erahnen und nicht zuverlässig diagnostizieren. Dafür ist die Komplexität der vielen, oft miteinander verknüpften, Faktoren, die Veränderungen in der Struktur einer Volkswirtschaft bewirken, schlicht zu hoch.
Immerhin ist aber im Rückblick meistens ein klarer Befund möglich. So würde heute kaum jemand mehr bestreiten, dass die vermeintliche De-Industrialisierung der Schweizer Wirtschaft in den 1970er-Jahren tatsächlich ein normaler und zudem ein überfälliger Strukturwandel war. Normal ist allerdings gar nicht mit harmlos gleichzusetzen.
Tatsächlich war das zeitliche Zusammenfallen des ersten Erdölpreisschocks von 1973 mit dem Zusammenbruch des internationalen Systems fester Wechselkurse (Bretton Woods) so etwas wie ein perfekter Sturm für die Schweizer Wirtschaft.
Der durch den hohen Erdölpreis bedingte Nachfrageeinbruch in allen für die Schweizer Exportwirtschaft wichtigen Abnehmerländern ging einher mit einer beispiellosen Aufwertung des Frankens. Ganze Branchen verloren über Nacht ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit. Allerdings hatten sie diese in den Jahren davor in manchen Fällen mit zweifelhaften Mitteln erlangt.
Die starke Zuwanderung von wenig qualifizierten Arbeitskräften aus Südeuropa verhalf den Industrieunternehmen in den 1950er- und 1960er-Jahren zu einem starken Wachstum. Das Anheuern billiger Arbeitskräfte war einfacher als Investitionen in moderne Maschinen. So erhöhte sich die Beschäftigung, aber die Produktivität entwickelte sich in die falsche Richtung – nach unten.
Zehn Jahre Stagnation
Das rächte sich dramatisch in der Krise. Die vielleicht spektakulärste Massenentlassung in der jüngeren Schweizer Industriegeschichte erinnert bis heute daran. Am 31. Juli 1978 gab Firestone die Schliessung der Reifenfabrik in Pratteln BL bekannt – wegen der hohen Produktionskosten und des teuren Frankens, wie der Fabrikdirektor seinen 800 Arbeiterinnen und Arbeitern eröffnen musste. Unter ihnen waren viele, die aus Italien oder Spanien hergekommen waren.
Die gleiche Industrie, die 1970 aus eigennützigen Motiven und mit vereinten Kräften geholfen hatte, die Schwarzenbach-Initiative zu bekämpfen, und sich so die Ressource an billigen Arbeitskräften erhielt, hatte für diese Menschen plötzlich keine Verwendung mehr. Zwischen 1973 und 1978 nahm die Beschäftigung in der Schweiz um acht Prozent ab. Im Vergleich zum Ausland blieb die Arbeitslosenquote aber relativ gering, weil das Problem der Arbeitslosigkeit mithilfe des damaligen Saisonnier-Status in die Herkunftsländer der Arbeitsmigranten zurückexportiert werden konnte.
Es dauerte fast zehn Jahre, bis die Schweiz den im Zug der damaligen Strukturkrise entstandenen Wohlstandsverlust ausgleichen konnte. In den 1980er-Jahren stellte sich wieder Wachstum ein. Auch in der EU machte die Eurosklerose endlich einer optimistischeren Stimmung Platz. Die Aussicht auf die Vollendung des EU-Binnenmarktes (1993) weckte allenthalben Frühlingsgefühle. Einer der grössten offenen Märkte der Welt war am Entstehen.
Die Menschen sollten ohne Hindernisse an den Grenzen dort arbeiten können, wo sie für sich selbst die besten Bedingungen sahen. Das Kapital sollte frei von Beschränkungen in die aussichtsreichsten Projekte geleitet werden können. Das sind die wichtigsten Voraussetzungen dafür, dass die Ressourcen dorthin gelangen, wo sie den grössten Nutzen stiften. Der Prozess fördert die Spezialisierung, vom einzelnen Menschen, der individuellen Firma bis zu grösseren geografischen Räumen.
Utz-Gruppe: Wie neue Geschäftsmodelle entstehen
«Wir hatten das Glück, früh zu merken, dass der sich in den 1980er-Jahren beschleunigende Prozess der Globalisierung ein neues Geschäftsmodell erforderte», sagt Axel Ritzberger, CEO der Utz-Gruppe mit Sitz im aargauischen Bremgarten. In dem vor sechs Jahren eröffneten Fabrikneubau in der Industriezone der beschaulichen Kleinstadt produziert das Unternehmen Lagergebinde aus Kunststoff. «Wir realisierten rasch, dass sich der Transport von leichten, aber voluminösen Behältnissen über weite Strecken nicht rechnen würde», erzählt Ritzberger die Geschichte, die er selbst nur noch vom Hörensagen kennt. Auf den Fersen der sich internationalisierenden Kunden expandierte auch Utz ins Ausland – zunächst in Europa, ab 2003 in Übersee.
Inzwischen ist Utz mit 1350 Angestellten in acht Fabriken auf drei Kontinenten tätig. Das Geschäftsmodell vom Hersteller einfacher Kunststoffkisten hat sich längst zum Anbieter individueller Lager- und Logistiklösungen verändert. Die Behältnisse sind millimetergenau auf die voll automatisierten Lagerbewirtschaftungssysteme einer Kundschaft zugeschnitten, in der es geradezu wimmelt von Namen globaler Grosskonzerne.
Utz verkauft heute maximale Zuverlässigkeit, Präzision, Flexibilität und die Bereitschaft zur Innovation. So wie Edi Fischer Motorex ein Chemieunternehmen nennt, könnte man Utz als Ingenieurunternehmen bezeichnen. In Bremgarten sorgen die mithin teuersten Spritzgussmaschinen, die in der Schweiz im Einsatz sind, für eine effiziente Produktion. Zur Steuerung der vollautomatischen Maschinen braucht es hochqualifizierte Facharbeiter, die in der Lage sind, das Produktionsprogramm der Ingenieure ohne Ausschuss umzusetzen.
Gemäss den Angaben von Axel Ritzberger hat sich die Zahl der Beschäftigten im Werk Bremgarten im Laufe der vergangenen Jahre auf gegen 250 Personen erhöht. Deren Pro-Kopf-Umsatz belaufe sich auf ein Mehrfaches des mittleren Bruttolohnes (Median) für eine Vollzeitstelle in der Schweiz von aktuell 82’000 Franken. Der Pro-Kopf-Umsatz sei in den vergangenen Jahren kontinuierlich um etwa fünf Prozent pro Jahr gestiegen.
Von Produktivität und Spezialisierung
Die Aussage deckt sich mit dem Befund von Rutzer und Weder, nach der sich die reale (teuerungsbereinigte) Wertschöpfung (Umsatz) der Schweizer Industrie seit 1980 in etwa verdoppelt hat. Die Feststellung ist bemerkenswert. Denn aufgrund der kräftigen Zunahme der Produktivität als Folge von Automatisierung hätte man sich leicht auch einen Umsatzrückgang wegen sinkender Preise vorstellen können.
Dass dies im Unterschied zu vielen anderen Ländern nicht geschah, ist das Ergebnis einer Spezialisierung. Der britische Ökonom David Ricardo formalisierte zu Beginn des 18. Jahrhunderts als erster das Prinzip des komparativen (vergleichenden oder relativen) Kostenvorteils. Das Prinzip besagt, dass der Handel am meisten Wohlstand schafft, wenn sich alle darauf beschränken, zu tun, was sie – gemessen an den Kosten – relativ am besten können.
Eine Methode, um festzustellen, in welchen Produkten ein Land komparative Kostenvorteile aufweist, ist die Messung der relativen Exportperformance einzelner Güter. Die Methode stammt vom ungarisch-amerikanischen Ökonomen Béla Balassa und geht davon aus, dass das, was ein Land im Vergleich zu anderen Ländern am besten produziert beziehungsweise exportiert, tatsächlich auch dessen relativen Kosten- oder Wettbewerbsvorteil (Revealed Comparative Advantage) abbildet.
Statistiken der Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung (Unctad) zeigen, dass sich die Anzahl Güterklassen, in denen die Schweiz einen solchen Vorteil aufweist, in den vergangenen 30 Jahren etwa halbiert hat. Die Schweizer Wirtschaft hat also eine extreme Spezialisierung durchlaufen, und Rutzer und Weder haben eine starke Konzentration auf Hightech-Güter festgestellt.
Cicor-Gruppe: Im Rückwasser einer Erfolgsbranche
Der Hauptsitz der Firma Cicor befindet sich in einem ganz auf Funktionalität getrimmten Fabrikneubau in der Industriezone der Gemeinde Bronschhofen bei Wil im Kanton St.Gallen. Die Firma erledigt Produktionsaufträge von Leiterplatten und elektronischen Komponenten. 400 der weltweit 2700 Angestellten arbeiten in der Schweiz, 220 in Bronschhofen. Jeder Sechste hier besitzt ein Diplom als Ingenieur. Cicor bewegt sich in einem Markt von gigantischen Dimensionen.
Mit einem Jahresumsatz 2023 von 390 Millionen Franken sind die Schweizer ein Zwerg. Doch die Firma wächst rasant, aus eigener Kraft und durch Übernahmen. Trotz zittriger Industriekonjunktur sind die Verkäufe im Vorjahresvergleich kräftig gestiegen. «Nearshoring», erklärt CEO Alexander Hagemann. Der Begriff beschreibt einen generellen Industrietrend, der sich aufgrund der Unterbrechungen globaler Lieferketten während der Pandemie stark beschleunigt hat. Firmen wollen die Auftragsentwicklung und Produktion von wichtigen elektronischen Komponenten wieder in ihrer Nähe wissen. Der Preis ist bei solchen Entscheidungen offensichtlich ein weniger wichtiges Kriterium als Verfügbarkeit, Sicherheit und nicht zuletzt die Qualität. Cicor operiert mit respektablen Gewinnmargen.
Während vieler Jahre kam die Firma kaum vom Fleck. Der Durchbruch gelang unter anderem im Rückwasser erfolgreicher Schweizer Medizintechnikfirmen. Die Herstellung elektronischer Schaltungen im Mikroformat für Hörgeräte, Herzschrittmacher, aber auch Steuerungselemente für grössere medizintechnische Apparate sind noch immer eine Spezialität von Bronschhofen und der beiden anderen Schweizer Cicor-Betriebe Boudry und Wangs. Hagemann sagt, Cicor produziere Hightech.
Vor allem aber beliefert Cicor hochregulierte Branchen mit der Sicherheit, dass Normen und internationale Standards eingehalten werden. Dieses Know-how verkauft Cicor an führende Unternehmen in ganz Europa und auch in Übersee. Die 17 Cicor-Fabriken in Europa, Nordafrika und Asien tauschen viel Wissen und Erfahrung aus. Das Geschäftsmodell von Cicor trägt unverkennbar die Züge der hochspezialisierten und auf Spitzentechnologie getrimmten Schweizer Exportindustrie.
Übergewichtige Städte?
Die Industrie-Safari ist zu Ende. Die Bahn bringt uns zurück nach Zürich, wo alles eine bisschen wichtiger, ein wenig grösser und gern auch etwas protziger daherkommt als draussen in Langenthal, Bronschhofen oder Bremgarten. Ein schöner Teil des in den Schweizer Industriezonen geschaffenen Wohlstandes findet auf verschlungenen Pfaden auch den Weg in die Finanzstadt. Es beschleicht einen das Gefühl, dass sich das längerfristige Schicksal der fleissigen Schweizer Industrie hier in Zürich oder im gemütlicheren, aber nicht minder wohlgenährten Bern entscheiden könnte, wo mehr Bleistifte gespitzt und weniger gebohrt, gestanzt oder gelötet wird.
In den grösseren Städten werden viele Dienstleistungen produziert. Deren Nutzen und die Wirtschaftlichkeit ihrer Herstellung muss den Leistungen der Industrie ebenbürtig sein, damit nicht alle zu viel für zu wenig zahlen müssen. Sollte die Ökonomie in den grösseren Städten zum Mühlstein der ganzen Wirtschaft werden, droht die Gefahr, dass auch den produktivsten Menschen im Land die Arbeitsmoral abhandenkommt. Dann ist es um den Wohlstand aller geschehen. Aber wie produktiv sind die Banken, die Versicherungen, die Spitäler und die Behörden wirklich? Das soll die nächste Probe aufs Exempel zeigen.






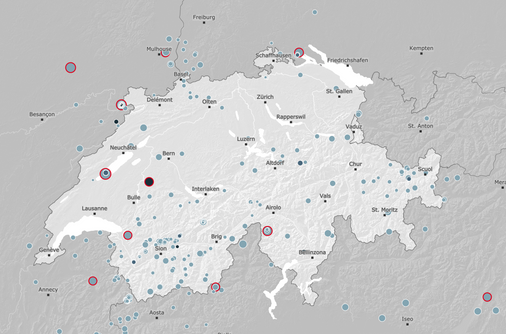


Kommentar (0)
Schreiben Sie einen Kommentar. Stornieren.
Ihre E-Mail Adresse wird nicht veröffentlicht. Die Pflichtfelder sind mit * markiert.