Ehemalige Kolonialstaaten wie Frankreich blicken anders auf den Nahostkonflikt als das mit dem Holocaust-Erbe beladene Deutschland. Der Schweizer Theatermacher kennt beide Positionen in diesem Kulturkampf. Und er sagt: Bei der konkreten Lösung von Konflikten helfen diese Debatten leider nicht viel weiter.
Milo Rau, wo man auch hinschaut, antisemitische Wortmeldungen aus linken Kreisen. Was ist da los?
Ich glaube, dass der Begriff Antisemitismus, ähnlich wie Rassismus und Kolonialismus, gerade sehr entgrenzt verwendet wird. Nicht jede Kritik an Israel ist antisemitisch – und nicht jede Unterstützung Israels ist «Apartheid», wie gewisse linke Kreise behaupten. Die politischen Lager bewirtschaften auf dem Rücken des Nahostkonflikts ihre Schuld- und Traumathemen. Bei der konkreten Lösung helfen diese Debatten leider nicht wirklich weiter.
Die Antisemitismus-Debatte, die wir gerade führen, ist also überflüssig?
Natürlich nicht – zum Glück wird sie geführt. Aber der Begriff wird zurzeit leider gern für lokale Diskursgewinne missbraucht, um Gegner zu diskreditieren. Das geht so weit, dass selbst israelische Bürgerinnen und Bürger, die Kritik an der Politik der Regierung Netanyahu üben, als Antisemiten bezeichnet werden. Antisemitismus ist aber nicht eine politische Meinung, sondern ein Verbrechen, nämlich die Absicht, jüdische Menschen weltweit auszurotten. Dagegen müssen wir entschieden vorgehen.
Was meinen Sie konkret, wenn Sie von den Schuld- und Trauma-Themen sprechen, die dem Nahostkonflikt übergestülpt werden?
Ich pendle viel zwischen dem deutschsprachigen Raum und Ländern wie Belgien und Frankreich hin und her. Wenn ich mich in Belgien oder in Frankreich aufhalte, dann wird der Nahostkonflikt als Kolonialkonflikt interpretiert. Das koloniale Trauma und die Schuld der ehemaligen Kolonialstaaten stehen im Zentrum der Diskussion. Es fallen dann Begriffe wie «Völkermord» und «Apartheid»-Regime, aber in Bezug auf Israel. In Deutschland oder in Österreich liest man den Konflikt durch die Brille der deutschen und österreichischen Schuld an der Vernichtung der europäischen Juden. Wenn jemand Israel kritisiert oder gar angreift, dann wird das in der Logik dieses Traumas gedeutet. Diese zwei komplett verschiedenen Lesarten, die beide nicht unwahr sind, drohen Europa zu zerreissen. Wir müssen diese Schuld- und Trauma-Perspektiven zusammen denken, anstatt sie ständig gegeneinander auszuspielen.
Wie wirkt sich dieser Kulturkampf auf Ihr Umfeld aus?
Ich hatte letzte Woche in Belgien eine Theaterpremiere, an der auch eine Journalistin der grössten belgischen Tageszeitung zugegen war. Die Journalistin hielt eine Colaflasche in der Hand. Ich sagte scherzhaft: «Weg damit, Coca-Cola ist ein fieser Konzern.» Worauf sie konterte: «Ich kann das trinken, Cola steht nicht auf der Boykottliste des BDS.» BDS steht für Boycott, Divestment and Sanctions, die Organisation will den Staat Israel isolieren. Wie verrückt ist das denn, bitte? Die Journalisten Belgiens richten sich nach der Boykottliste einer Organisation, die in Deutschland und Österreich als antisemitisch eingestuft und verboten wurde. In Belgien gehört aber jeder Künstler und Intellektuelle zum BDS, ich war eine Ausnahme.
Sie wirken in beiden Sprachräumen, inszenieren, kuratieren. Wie gerät man da nicht ins Fahrwasser?
Die Fronten sind tatsächlich extrem. Gerade habe ich für eine deutschsprachige Zeitung einen Essay geschrieben, in dem ich darlege, warum ich die Netanyahu-kritische französische Nobelpreisträgerin Annie Ernaux und den ehemaligen griechischen Finanzminister Yanis Varoufakis, der Israel für den Militärschlag in Gaza anklagt, in den sogenannten Rat der Republik der Wiener Festwochen eingeladen habe, ein beratendes Gremium aus 100 Menschen, zu dem übrigens auch viele jüdische Intellektuelle gehören. Ich musste diesen Essay völlig umschreiben, bevor ich ihn einer belgischen Zeitung anbieten konnte. Man hätte dort schlicht nicht durchgehen lassen, warum ich überhaupt versuche, israelische Positionen zu verstehen.
In der Schweiz wirft man dem Zürcher Theater Neumarkt vor, es habe libanesische Rechtssprechung übernommen, weil man zum Schutz einer libanesischen Ensembleschauspielerin sie und ihren israelischen Kollegen getrennt beschäftigt habe. Solche Probleme dürften im internationalen Kunstzirkus an der Tagesordnung sein. Wie gehen Sie damit um?
Konflikte, die in der realen Welt nicht mehr ausdiskutierbar sind, müssen gerade in der Kunst einen antagonistischen, streitbaren Raum bekommen, wo Auseinandersetzung möglich ist. Ich finde natürlich, dass im Raum der Kunst, zudem in einem Schweizer Theater, libanesisches Recht keine Gültigkeit haben sollte. Aber jeder Fall ist natürlich ein spezieller Fall, ich kenne ihn zu wenig. Die Debatte jedenfalls ist superwichtig.
Das funktioniert doch auch bei Ihnen nicht. Der russisch-griechische Dirigent Teodor Currentzis hätte an den Wiener Festwochen im selben Programm wie die ukrainische Dirigentin Oksana Lyniv ein Requiem aufführen sollen. Das gefiel nicht allen. Am Ende mussten Sie Currentzis ausladen.
Ja, leider. Das Bilden schwieriger Konstellationen gehört zu meinem künstlerischen Programm. Ich hatte gehofft, dass wir am Festival diesen streitbaren Ort schaffen können. Currentzis wird ja vorgeworfen, dass er sich nie öffentlich von Putin distanziert hat. Ihm gegenüber wäre Oksana Lyniv mit dem ukrainischen Staatsorchester gestanden. Beide Parteien waren damit einverstanden, in dieser Form in einen Dialog zu treten. Hier, wie übrigens in den meisten Fällen, scheiterte die Begegnung am Ende nicht an den Beteiligten selbst, sondern am Druck der Öffentlichkeit.
Waren Sie da nicht etwas naiv?
Im Nachhinein sicherlich. Aber bei vielen meiner Projekte hat das funktioniert. In «Das Neue Evangelium» habe ich in Süditalien mit Kleinbauern, Migranten und Bewohnern der Stadt Matera die Leidensgeschichte von Jesus nachgespielt. Italienische Kleinbauern und afrikanische Migranten werden in dieser Region häufig gegeneinander ausgespielt. Bei uns haben sie zum ersten Mal zusammengearbeitet und gemeinsam eine Bewegung gegründet.
Ganz ausblenden kann man die Realität aber nicht: Dass sich Künstlerinnen wie Lyniv nicht mit einem von Putin finanzierten Künstler auf eine Bühne stellen, hat auch seine Berechtigung.
Es wäre sicher falsch, zu behaupten, Kunst stehe über allem. Das Orchester von Oksana Lyniv ist ein Staatsorchester. Da sagt der Staat, gut, ihr könnt das machen, aber dann entlassen wir euch. Es wurde Druck ausgeübt, Lyniv vorgeworfen, dass sie Russland weisswaschen wolle. Als Kurator verteidige ich den Raum der Kunst natürlich bis zum Letzten, aber im Endeffekt ist meine Meinung als Kurator in solchen Fragen nicht entscheidend. Wichtig sind am Ende die Bedürfnisse der Künstler, die respektiere ich.
Werden bei Aktionen wie dem Zusammenbringen verfeindeter Kriegsparteien nicht zu viel Heilsversprechen in die Kunst projiziert?
Die Diskursräume schliessen sich gerade. Neben Lyniv, die sich dem öffentlichen Druck beugen musste, haben sich im Rahmen der Wiener Festwochen in anderen Projekten ukrainische Aktivistinnen sogar geweigert, mit russischen Dissidenten wie Pussy Riot gemeinsam auf unserer Bühne zu stehen. Das sind keine verschrobenen Nationalistinnen, sie können das aktuell einfach nicht. Krieg zerstört die Bindungsfähigkeit der Menschen bis in die Wurzeln, es gibt nur noch ein Wir und ein Sie. Trotzdem: Die Idee der Kunst als Raum des Rituals, der Begegnung und vielleicht der Heilung ist bis zuletzt zu verteidigen.
Ab welchem Zeitpunkt wäre denn eine Aufarbeitung dieser Traumata im Rahmen der Kunst sinnvoll?
Ich habe bei der Beschäftigung mit verschiedenen Konflikten für mich herausgefunden, dass es ungefähr eine Generation braucht, bis die Menschen eine genügend grosse Distanz zum Erlebten gewinnen. Das war auch bei meinem Projekt «Hate Radio» so, in dem ich mit Vertretern der Volksgruppen Tutsi und Hutu den Völkermord in Ruanda thematisierte, der sich gerade zum 30. Mal jährt.
Distanz zum Theatermacher Milo Rau und seiner Arbeit scheint es in der Öffentlichkeit nicht zu geben. Wieso ist man eigentlich immer für oder gegen Sie?
Ich glaube, das liegt an der Radikalität des Realismus, den ich in meiner Arbeit verwende. Meine «Antigone im Amazonas», die ab Samstag in Zürich läuft, ist unglaublich direkt, stellenweise unerträglich. Und es liegt daran, dass wir ganz grundsätzlich in einer Zeit leben, wo man immer für oder gegen etwas ist. Meistens sind die Leute gar nicht wegen meiner Stücke oder Bücher gegen mich, sondern aufgrund von Vorstellungen, die sie von mir haben. Man wirft mir politische Rechthaberei vor, Eitelkeit und Narzissmus im Namen der Kunst. Wenn ich diese Vorwürfe gegen mich lese, denke ich manchmal, es steckt natürlich auch etwas Wahres drin.
Der Schweizer Regisseur Milo Rau, 47, gehört zu den einflussreichsten Theaterschaffenden der Gegenwart. Seine direkt auf die Gegenwart zielenden Re-Lektüren klassischer Stoffe und seine theatralen Nachstellungen von Konflikten begeistern weltweit. Der bekennende Marxist verantwortet in diesem Jahr zum ersten Mal die Wiener Festwochen. In Wien ist ihm in diesen Tagen ein kleiner Coup gelungen: Rau darf das jahrzehntelang gesperrte Skandalstück «Burgtheater» von Elfriede Jelinek endlich an dem Ort inszenieren, für den es mal vorgesehen war: an der Wiener Burg. Die Nobelpreisträgerin hat dem Theatermacher ihren Segen dazu gegeben. Am Zürcher Schauspielhaus steht am 27./28./29.4. sowie am 7./8.5. Raus «Antigone im Amazonas» auf dem Programm, eine Auseinandersetzung mit der grössten Landlosenbewegung der Welt im Amazonasgebiet. (jst)
Sind Sie denn eitel?
Na ja, auf Äusserlichkeiten bezogen habe ich keinen Grund (lacht). Aber viele stört wohl, dass bei meiner Kunst der Aktivismus nicht weit ist. Ich erkläre immer öffentlich, was ich zu machen versuche, Praxis und Theorie sind bei mir nicht getrennt. Ich finde es schön, wenn ein Künstler keine Ödipus-Figur ist, die blind vor sich hinarbeitet, sondern versucht zu verstehen, was sie tut und warum. Wobei mir wichtig ist: Ich kritisiere immer nur Strukturen, nie Menschen. Und vor allem meine eigene Arbeit. Was natürlich per se ein eitles Konzept ist.
… das beim einen oder anderen auch unschöne Erinnerungen an die Schule wachruft.
Dabei sind meine Stücke gar keine Welterklärungsstücke! Ich erinnere mich an eine Kritik aus der «Süddeutschen Zeitung» zu «Hate Radio», in der stand, in zwei Stunden Milo Rau lerne man weniger als in einer Minute Fernsehen. Viele meiner Stücke, etwa «Medeas Kinder», das gerade Premiere hatte, lassen die Zuschauer in tiefster Ratlosigkeit zurück. Wenn man bei meinem Theater in die Schule gehen will, dann viel Glück!
Die Welt geht aber bei Ihnen öfters in die Schule: Vor zwei Jahren haben Sie den St.Gallern erklärt, dass ihre Mumie in der St. Galler Stiftsbibliothek nach Ägypten gehöre. Nun ruht sie immer noch friedlich im Glaskasten. Ist Ihr Projekt, Sie da rauszuholen, gescheitert?
Auf der einen Seite glaube ich, dass die Debatte, so schmerzhaft und wirr sie auch war, ein Umdenken herbeigeführt hat. Güter werden restituiert. In der ganzen Welt hinterfragt man die Besitzverhältnisse in Museen. Auch bei ethischen Fragen zur Präsentationsweise von Mumien hat sich etwas im Bewusstsein der Menschen verschoben. Und auch auf ägyptischer Seite hat die Zivilgesellschaft eingesehen, dass es neue Museen für diese Mumienrückführungen braucht. Es ist dort ja nicht besser als bei uns.
Sie wollen diese von Forschern und Politikern seit Jahren mitgetragene Entwicklung ernsthaft auf die Debatte zurückführen, die Sie in St.Gallen angestossen haben?
Ganz im Gegenteil: Ich glaube, dass die St.Galler Debatte so breit war, weil die ganze Welt seit einigen Jahren über die Fragen historischer Gerechtigkeit und Restitution kolonialer Güter spricht. Da sind die St.Galler, wie immer, eher spät dran. Aber der Moment hat gestimmt: Letzthin war ich in Brüssel und sah Schepenese auf der Titelseite einer Zeitung zum Thema Restitution. Unsere Mumie ist jetzt das Symbol einer Debatte, die längst nicht an ihrem Ende ist.
Sie haben damals, als die Intendanz in Zürich zur Verfügung stand, abgelehnt. Es sei zu früh, meinten Sie, und gingen nach Gent, jetzt nach Wien. Wäre der Intendantenposten in Zürich nicht wenigstens etwas für die letzten Jahre vor der Pensionierung?
Das ist zum Glück noch etwas hin. Aber ausschliessen will ich es nicht. Der einzige Grund, warum ich Bedenken habe, fest in die Schweiz zurückzukehren, ist, dass man hier als Künstler viel zu wenig angegangen wird. So sehr ich die Antisemitismus- und Kolonialismus-Debatte ja auch infrage stelle: Sie ist wichtig und wird in der Schweiz zu wenig geführt. Man muss einer Stadt schon die Mumie wegnehmen, damit es Streit gibt.
Als Christoph Schlingensief in Zürich den «Hamlet» mit Nazis spielte, sorgte das durchaus für Empörung!
Aber niemals in dem Ausmass wie etwa in Wien mit seinem «Ausländer Raus»-Projekt! Ich erinnere mich noch gut an diese eine Szene, in der eine Frau während der «Hamlet»-Inszenierung aus dem Pfauensaal läuft. Schlingensief rennt ihr hinterher und ruft: «Ach so, sie wollen sicher Ihr Geld zurück. Hier ist das Geld.» Und sie dreht sich zu ihm um und sagt voller Verachtung: «Ich habe ein Abonnement.» Das war so typisch Zürich. Man freut sich total über gutes Theater, aber wenn einem jemand zu nahe kommt, blockt man ab. Alles, was radikal ist, wird hier als moralisch oder emotional übergriffig empfunden. Man will sich einfach nicht berühren lassen, glaube ich. Aber Zürich verändert sich ja auch, und wenn wir schon über Pensionierung sprechen: Wer weiss? In zwanzig, fünfundzwanzig Jahren ist das alte Zürich untergegangen. Und dann werde ich mich mit Gicht geplagten Füssen zurückschleppen in die Schweiz. (Lacht.)






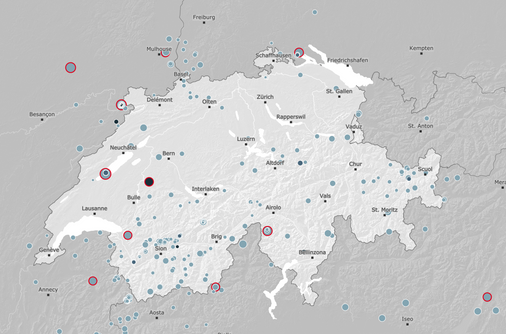


Kommentar (0)
Schreiben Sie einen Kommentar. Stornieren.
Ihre E-Mail Adresse wird nicht veröffentlicht. Die Pflichtfelder sind mit * markiert.