Seit 50 Jahren dürfen Frauen in der Schweiz wählen und abstimmen. Dafür haben Freiburgerinnen hartnäckig gegen konservative Meinungen und gegen die Kirche gekämpft.
Vor 50 Jahren haben die stimmberechtigten Schweizer Männer das Wahl- und Stimmrecht für Frauen angenommen. Hommage 2021 ehrt den jahrzehntelangen Überzeugungskampf von Frauen (siehe Kasten). Im Interview spricht Irma Gadient von der Universität Freiburg über die Rolle von Freiburger Pionierinnen. Die Historikerin hat für Hommage 2021 die Geschichte von fünf Freiburger Frauenrechtsaktivistinnen recherchiert: Augusta Kaelin-Anastasi, Anne Reichlen-Gellens, Liselotte Spreng, Jeanne Niquille und Madeleine Emma Joye-Thévoz.
Wieso ist es wichtig, dass wir 50 Jahre Frauenstimmrecht feiern?
Wir ehren Frauen, die sich – stellvertretend für viele Generationen von Frauen – für das Frauenstimm- und Wahlrecht eingesetzt haben. Die Hommage 2021 bietet einen Moment, an die Pionierinnen zu denken und uns zu freuen. Gleichzeitig erlaubt sie auch den kritischen Blick nach vorne. Der Kampf für Gleichberechtigung geht weiter.
Die Ausstellung von Hommage 2021 in der Münstergasse stellt die beiden Freiburgerinnen Madeleine Emma Joye-Thévoz und Liselotte Spreng vor. Weshalb die beiden?
Die Vorgabe des Projekts Hommage 2021 war, dass Expertinnen für jeden Kanton Frauenporträts erarbeiten. Es sollte sich um Pionierinnen handeln, die bereits verstorben sind. Eine Schulklasse des Kollegiums Gambach wählte nach meiner Präsentation zwei Frauen aus. Das Ziel von Hommage 2021 ist es, dass auch eine jüngere Generation, 14- bis 20-jährige Jugendliche, am Projekt beteiligt ist.
Für welche zwei Frauen hätten Sie gestimmt?
Alle Frauen haben es verdient, sicht- und hörbar zu sein. Meine Auswahl wurde von der Quellenlage mitbestimmt. Es gibt noch nicht viel Forschung zur Freiburger Stimm- und Wahlrechtsbewegung. Ich habe verschiedene Spuren verfolgt. Aufgrund der verfügbaren Quellen sind in meiner Auswahl vor allem Frauen, die zum bürgerlichen Milieu gehörten. Es gäbe auch Sozialistinnen und viele Frauen, die noch leben, die sich für das Stimm- und Wahlrecht starkgemacht haben.

zvg
Was hat Sie an diesen fünf Frauen fasziniert?
Sie haben mit grossem Engagement und vielfältigen Strategien für das Frauenstimmrecht gekämpft. Gemeinsam war ihnen die gute Ausbildung. Herkunft und Lebensentwürfe sind unterschiedlich: Anne Reichlen-Gellens ist in Belgien geboren, Augusta Kaelin-Anastasi im Tessin. Andere Frauen wie Liselotte Spreng waren verheiratet und mussten Ausbildung und Beruf mit der Mutterschaft vereinbaren. Jeanne Niquille blieb möglicherweise nicht freiwillig ledig: Ihre Anstellung als Hilfsarchivarin beim Kanton hätte sie verloren, wenn sie geheiratet hätte. Die Ehe bedeutete damals oft das berufliche Ende. Zudem blieb ihr die Stelle der Kantonsarchivarin verwehrt, obwohl sie bestens für die Stelle qualifiziert gewesen wäre. Diese Diskriminierung in der Arbeitswelt ist mir durch die Arbeit für Hommage 2021 stark bewusst geworden.
War es für Freiburgerinnen schwieriger als für andere Schweizerinnen?
Die erste Abstimmung von 1959 zeigt, dass im Kanton Freiburg 70 Prozent der stimmberechtigten Männer das Stimm- und Wahlrecht ablehnten. Der Schweizer Durchschnitt lag mit knapp 67 Prozent etwas darunter. 1971 sagten dann 71 Prozent der Freiburger Ja. Das war ein wenig mehr als der Schweizer Durchschnitt.
Was ist passiert?
Der Umbruch von 1968 prägte die Gesellschaft. Zahlreiche Veränderungen, darunter auch Innovationen wie Kühlschrank oder Antibaby-Pille, wirkten sich auf die Geschlechterverhältnisse aus. Das hat auch die katholisch geprägte Freiburger Gesellschaft verändert.
Was war die Rolle der Kirche?
1959 sagte die Kirche in Freiburg Nein zum Frauenstimm- und Wahlrecht. Die bürgerlichen Parteien beschlossen Stimmfreigabe, was mit Nein gleichzusetzen ist. 1971 befürworteten diese Akteure das Frauenstimmrecht. Ein wichtiger Grund für diesen Meinungsumschwung war das Engagement der Freiburgerinnen.
Wie sah ihr Engagement konkret aus?
Es war sehr vielfältig. Sie vernetzten sich kantonal und national und waren sehr initiativ. Madeleine Joye-Thévoz zum Beispiel besuchte mit 18 Jahren einen Kurs von Genfer Frauenrechtlerinnen, die lehrten, Frauenstimmrechts-Vereine zu gründen. Als einen Bereich möchte ich auch den Unterricht nennen: Madeleine Joye-Thévoz war Geschichts- und Literaturlehrerin. Sie machte ihre Schülerinnen mit feministischer Literatur bekannt. In den Jahren vor der Abstimmung 1971 erteilten zudem Oberstufenlehrpersonen interessierten Frauen ehrenamtlich Bürgerrechtsunterricht, oder eher Staatsbürgerinnenkunde. Damit erreichten sie Frauen in ländlichen Gebieten. Das Interesse daran war gross.
Schliesslich mussten die Frauen ihre Männer überzeugen. Waren diese Kurse dazu gedacht?
Dank den Kursen konnten die Frauen argumentieren, weshalb politische Gleichberechtigung normal sein sollte. In der Gemeinde war es sichtbar, wenn die Frauen in die Bürgerrechtskunde gingen. Das hat die ländlichen Regionen aufgewirbelt.
Haben Sie einen Unterschied zwischen dem deutschsprachigen und dem französischsprachigen Teil des Kantons festgestellt?
Es gab eher einen Stadt-Land-Graben. Sense- und Greyerzbezirk waren die ländlichsten Bezirke. Sie haben ähnlich abgestimmt, wobei die Ablehnung im Sensebezirk 1959 noch grösser war. Das Engagement von Frauen in diesen Bezirken war deshalb besonders wichtig – und ausschlaggebend dafür, dass der Kanton 1971 Ja stimmte. Innerhalb des Sensebezirks hat sich die Meinung in diesen zwölf Jahren am stärksten verändert: 1959 waren rund 87 Prozent der Sensler dagegen, 1971 waren rund 56 Prozent dafür.
Sie haben die Greyerzerin Augusta Kaelin-Anastasi porträtiert. Wie hat sie ihren ländlichen Bezirk überzeugt?
Augusta Kaelin-Anastasi organisierte zusammen mit anderen Frauen vor der Abstimmung 1971, dass Aktivistinnen in jedem Dorf des Greyerzbezirks mit Rosen auf die Menschen zugingen. Der Slogan lautete: «Oui de bon coeur». Diesen Slogan verwendeten auch die Senslerinnen: «Für die Frauen ein herzliches Ja!»
Dann gewannen sie 1971 mit stereotypischer Weiblichkeit?
Es gab durchaus Kritik von anderen Frauen an dieser Charme-Offensive. Die Frauen wussten aber, was für ihre Bezirke die adäquate Strategie war. Das Ziel aller Freiburger Kämpferinnen war dasselbe: das Frauenstimm- und Wahlrecht endlich zu erhalten. Liselotte Spreng argumentierte 1971 eher mit der Komplementarität von Frau und Mann. Die Frau sei eine Bereicherung für Politik und Nation mit ihrem Wissen und ihren Fähigkeiten.
Wie argumentierten die Frauen vor der ersten Abstimmung 1959?
Eine Exponentin dieser Zeit ist Madeleine Joye-Thévoz. Sie argumentierte mit dem Prinzip der Rechtsgleichheit von Frau und Mann. Hinzu kommt die Strategie der Historikerin Jeanne Niquille. Sie appellierte an eine Freiburger Tradition: In Zeitungsartikeln zeigte sie auf, dass gewisse Frauen in Freiburg bereits im 18. Jahrhundert politische Rechte hatten. In Villars-sur-Glâne gab es damals Gemeindepräsidentinnen, in anderen Gemeinden Gemeinderätinnen.
Welche Rolle spielten die Männer?
Sie waren es, die 1971 in einer Mehrheit das Frauenstimm- und Wahlrecht annahmen. Dass es soweit kam, ist in erster Linie dem Engagement von Frauen zu verdanken. Es gab in Freiburg auch sozialdemokratische Grossräte, die ihr Engagement ins Kantonsparlament trugen. Dieser Zugang war den Frauen ja verwehrt. Bereits 1950 kam es diesbezüglich zu einer Motion – ohne Erfolg. Im Vorfeld von 1971 gab es ein Unterstützungskomitee von Politikern. Auch Journalisten waren wichtige Mitstreiter.
Wann hat die Frauenstimmrechtsbewegung in Freiburg begonnen?
Im Vergleich zu anderen Kantonen spät. Anne Reichlen-Gellens legte den Grundstein, als sie 1928 in Bulle eine Gruppierung gründete. Sie brachte als Belgierin den Blick von aussen mit. 1947 gründete sie mit anderen Frauen die «Association féministe fribourgoise», die bald eine Sektion des «Schweizerischen Verbands für das Frauenstimmrecht» wurde. Die Bewegung gewann an Dynamik: Die Frauen verfassten Briefe an Zeitungen und erzwangen öffentliche Stellungnahmen des Staatsrats. Die Ausdauer der Frauen ist beeindruckend. 1959 war ihr Engagement nicht zu schwach – die Kirche und die konservativen Parteien waren eine zu starke Gegenmacht im Kanton.
Heute gibt es in Freiburg Vereine wie das Frauenstreikkollektiv. Ist ihr Engagement vergleichbar mit dem von vor 50 Jahren?
Es gibt zahlreiche Gemeinsamkeiten: Von der Energie und Solidarität der Kämpferinnen bis zur internationalen Vernetzung. Die Hoffnung der Aktivistinnen für das Frauenstimmrecht war, dass dadurch auch Diskriminierungen in anderen Bereichen verschwinden. Dem ist nicht so. Die aktuellen feministischen Bewegungen zeigen, dass der Kampf für Gleichberechtigung viel Ausdauer braucht. Das Frauenstreikkollektiv machte durch öffentlichen Widerstand den Sexismus an Freiburger Schulen publik und zeigt auf, dass das Thema von Frauenrechten im Kanton aktuell ist.
Irma Gadient hat die Geschichten von fünf Freiburger Pionierinnen recherchiert. In der folgenden Bildergalerie sind sie zusammengefasst:

Die 1888 in Antwerpen geborene Belgierin Anne Reichlen-Gellens (1888-1967) kam im ersten Weltkrieg in die Schweiz. Als Krankenschwester begleitete sie belgische Flüchtlingskinder. Reichlen-Gellens heiratete den Greyerzer Paul Reichlen und wohnte in Bulle. Sie hatten drei Kinder. In Bulle gründete sie 1928 eine Gruppierung, die 1932 Teil des Schweizerischen Verbands für das Frauenstimmrecht wurde. Mit anderen Freiburgerinnen gründete sie 1947 die «Association Féministe Fribourgoise». Hartnäckig lobbyierte sie für das Frauenstimm- und Wahlrecht und war auch mit Aktivistinnen aus anderen Kantonen vernetzt. Sie machte sich besonders für die autodidaktische weibliche Bildung stark. – zvg / Familienbesitz 
Jeanne Niquille (1894-1970) wurde 1894 in Freiburg geboren. Nachdem sie sich als Primarlehrerin ausgebildet hatte, schrieb sie sich an der Universität Freiburg ein. Das war Frauen erst ab 1905 gestattet. 1918 schloss sie ihr Doktorat in Geschichte mit Bestnote ab. Sie publizierte teilweise als erste Frau in wissenschaftlichen Zeitschriften. Niquille arbeitete im Freiburger Staatsarchiv. Trotz ihrer Qualifikationen blieb ihr das Amt der Kantonsarchivarin verwehrt. Unter anderem mit Artikeln in der Tageszeitung La Liberté kämpfte sie im Vorfeld der Abstimmung von 1959 für das Frauenstimmrecht. Sie blieb ledig, finanziell unabhängig. Auch äusserlich entsprach sie nicht der sozialen Norm, sie trug Hosen. – zvg / B. Rast 
Madeleine Emma Joye-Thévoz (1906-1989) kam 1906 in Freiburg als Tochter eines Kantonsbeamten und Mitglied der katholisch-konservativen Partei auf die Welt. In der Familie war Politik wichtig. Nach ihrem Studium arbeitete sie im Kollegium Heilig Kreuz als Geschichts- und Literaturlehrerin. Den Eltern musste sie einen Teil ihres Lohns für ihre Brüder und deren Ausbildung abgeben. Ihren Schülerinnen gab sie Kurse, um das Argumentieren zu üben. Von 1952 bis 1967 war sie Präsidentin des Freiburger Verbands für das Frauenstimmrecht. Sie organisierte grössere Veranstaltungen und verpflichtete den Staatsrat dazu, Farbe zu bekennen. Sie wurde als exzentrisch kritisiert und als intellektuell gelobt. – zvg / Hommage 2021 
1921 in Lugano geboren, zog Augusta Kaelin-Anastasi (1921-2011) 1939 fürs Studium nach Freiburg. Danach arbeitete sie als Gymnasiallehrerin im Tessin. Als sie heiratete, zogen die fussballbegeisterte Kaelin-Anastasi und ihre Familie nach Bulle. Ihren Beruf als Lehrerin musste sie aufgeben. Sie war CVP-Mitglied. Aus parteipolitischen Gründen durfte sie nicht Grossrätin werden. Ehrenamtlich unterstützte sie Familienfrauen. Vor der Abstimmung von 1971 gründete sie ein regionales Komitee des Freiburger Frauenstimmrechtsverbands. Ihren Slogan haben auch Senslerinnen verwendet: «Für die Frauen ein herzliches Ja». Ihre Tochter Thérèse Meyer-Kaelin war von 1999 bis 2011 CVP-Nationalrätin und 2005 Nationalratspräsidentin. – zvg / Familienbesitz 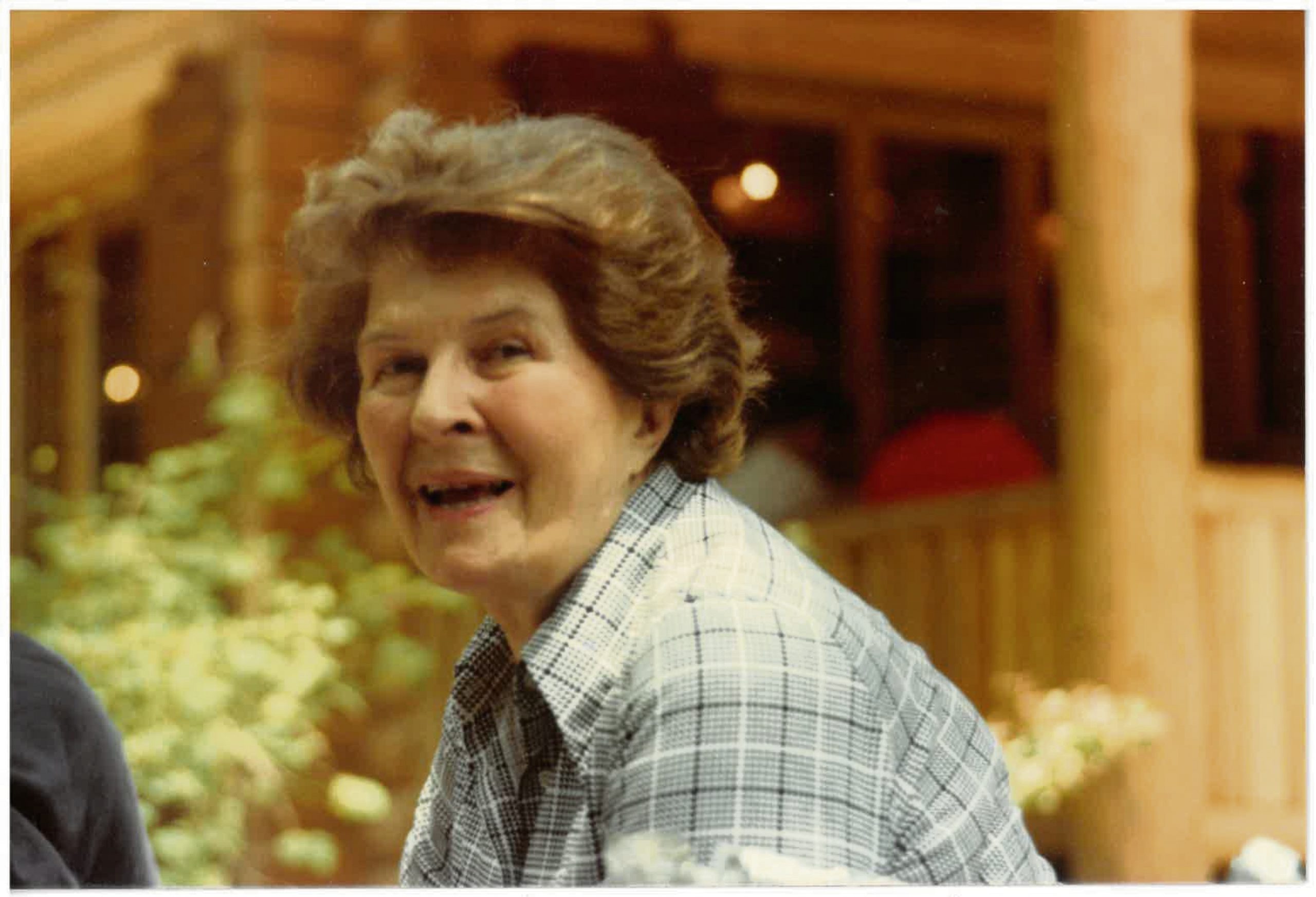
Liselotte Spreng-Brüstlein (1912-1992) wurde 1912 in Biel geboren. Als Tochter einer Ärztefamilie studierte sie Medizin. Ab 1939 war sie Teil der Frauenrechtsbewegung. Mit ihrem Ehemann Alfred Spreng führte sie ab 1940 eine gynäkologische Praxis in Freiburg – nicht üblich für diese Zeit. Während dem Zweiten Weltkrieg vertrat sie ihn und sorgte für die vier Kinder. 1967 übernahm sie das Präsidium des Freiburger Verbands für das Frauenstimmrecht. Nach dem erfolgreichen Abstimmungskampf von 1971 wurde sie FDP-Grossrätin und im selben Jahr die erste Freiburger Nationalrätin. Bis 1983 setzte sie sich auf nationaler Ebene für Familienrechte, humanitäre Organisationen und Medizinethik ein. – zvg / Familienbesitz
Vorschau
Eine Projektion zu Ehren der Kämpferinnen fürs Stimm- und Wahlrecht
Vom 6. bis 13. August findet auf dem Bundeshausplatz in Bern eine Panorama-Projektion statt. Sie erzählt den Kampf von Schweizerinnen, die sich für das Stimm- und Wahlrecht engagierten. Als Kulisse dienen die Fassaden der Nationalbank, des Bundeshauses und der Berner Kantonalbank. Das Publikum befindet sich so mitten in der Geschichte. Die mehrsprachige Projektion findet jeweils um 21.15 Uhr und 22 Uhr statt. Für den Zutritt braucht es ein Covid-Zertifikat. Bis am 15. August hängen zudem die Porträts von je zwei Frauen pro Kanton in der Münstergasse. Via QR-Code ist ihre Geschichte zu hören. Vom Kanton Freiburg sind dies Liselotte Spreng-Brüstlein und Madeleine Emma Joye-Thévoz. Die Porträts von Anne Reichlen-Gellens, Jeanne Niquille und August Kaelin-Anastasi sind zudem auf der Webseite vom Hommage 2021 aufgeschaltet: www.hommage2021.ch.


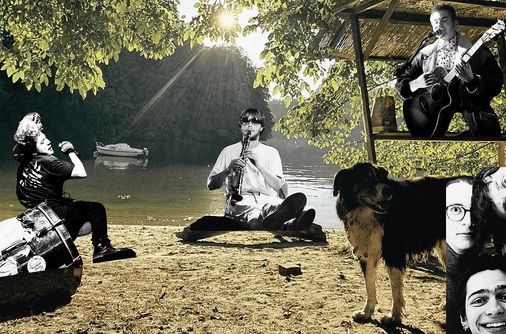



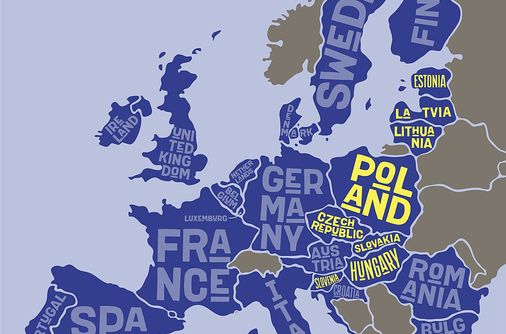

Kommentar (0)
Schreiben Sie einen Kommentar. Stornieren.
Ihre E-Mail Adresse wird nicht veröffentlicht. Die Pflichtfelder sind mit * markiert.